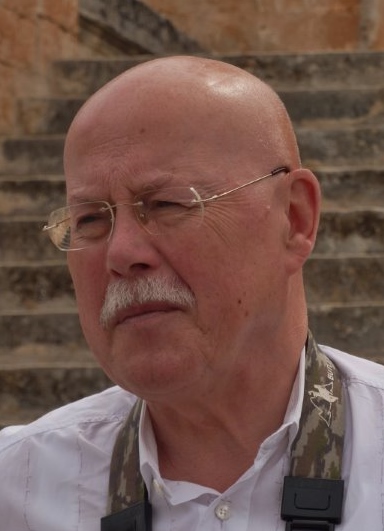Die massenhaften Vergewaltigungen in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges, aber auch bis in die fünfziger Jahre hinein, sind sehr lange ein Tabuthema in Deutschland geblieben. Dies, obgleich schon 1954 in einer offiziellen Dokumentation der Bundesregierung zur Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa auch dieses Thema ausführlich behandelt worden ist. Allerdings beschränkt sich diese Dokumentation auf die Geschehnisse im Osten. Die Untaten alliierter Soldaten im Westen und Süden Deutschlands werden darin nicht behandelt, was ja auch der Aufgabenstellung entspricht. Der Grund für diese bewußte Aussparung liegt auf der Hand: Das Verhältnis der bundesdeutschen Bevölkerung zu den neuen Alliierten sollte nicht durch die Darstellung von ihren Soldaten wenige Jahre zuvor massenhaft begangener Verbrechen belastet werden. Hinsichtlich der Staaten des Warschauer Pakts, insbesondere der Sowjetunion, galt natürlich das Gegenteil. Die Erinnerung daran, wie ihre Soldaten marodierend und vergewaltigend durch die östlichen Landesteile und Berlin gezogen waren, sollte durchaus wach gehalten werden. Wie ich aus eigener Erinnerung weiß, hatte das jedenfalls in den Jahren des Kalten Krieges auch einen positiven Einfluß auf die Motivation der wehrpflichtigen Soldaten und die Einstellung der Deutschen zu NATO und Bundeswehr.
Dennoch verblaßte im Lauf der Jahre auch die kollektive Erinnerung an diese Vorgänge im Osten. Erst in den letzten Jahren ist das Thema publizistisch und wissenschaftlich wieder in den Focus gerückt. Erstmals wurden nun auch die im Grunde genommen durchaus bekannten Verbrechen amerikanischer, britischer und französischer Soldaten zum Thema von Büchern und Zeitschriftenartikeln gemacht. Zwei dieser Arbeiten habe ich gelesen. Trotz des gleichen Themas könnten sie jedoch inhaltlich nicht unterschiedlicher sein. Es handelt sich zum einen um das Buch „Frau, komm!“ – Die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45 des Juristen Ingo von Münch (Ares Verlag, Graz 2009 ISBN 978-3-902475-78-7) und zum anderen um das Buch „Als die Soldaten kamen – die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs“ der Historikerin Miriam Gebhardt (Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2015 ISBN 978-3-421-04633-8). Ingo von Münch beschränkt sich thematisch auf die Vorgänge im Osten, während Miriam Gebhardt auch die Ereignisse im Westen und Süden Deutschlands behandelt.
Die Arbeit der Historikerin Gebhardt ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Daß sie hauptsächlich soziologisch angelegt ist, und nicht in erster Linie Ereignisgeschichte schreibt – „wie es denn gewesen ist“ (Leopold von Ranke, Thukydides) – ist der heute vorherrschenden Auffassung von Geschichtswissenschaft geschuldet. Nicht umsonst firmiert das wohl meistgenutzte Internetportal dieser Disziplin unter dem Titel „H-Soz-Kult“, einem Akronym für „Humanities – Sozial und Kulturgeschichte“. Die Forschungsschwerpunkte der Autorin spiegeln sich auch in den Titeln ihrer Werke wieder, die sie im Literaturverzeichnis des besprochenen Buches nennt (“ Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert“, „Alice im Niemandsland. Wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor“, und „Eine Frage des Schweigens? Forschungsthesen zur Vergewaltigung deutscher Frauen nach Kriegsende“). Welche Fragen die moderne historische Forschung offenbar bewegen, zeigt sich auch an Titeln in ihrem Literaturverzeichnis wie „Umkämpfte Maskulinität. Zur Historischen Kultursoziologie männlicher Subjektformen und ihrer Affektivitäten vom Zeitalter der Empfindsamkeit bis zur Postmoderne“. Ob es allerdings dieser Herangehensweise geschuldet ist, daß ihre Angaben zu den Opferzahlen insbesondere hinsichtlich der Vorgänge im Osten im Vergleich zu anderen Autoren außerordentlich niedrig ausfallen und auch zum Teil schlicht nicht nachvollziehbar sind, mag zunächst offen bleiben. Daß Opferzahlen nur grob geschätzt werden können, liegt auf der Hand und ist auch unstrittig. Gebhardt selbst erklärt, daß ihre Schätzungen sehr vorsichtig sind. Sie gibt die Gesamtzahl der von alliierten Soldaten vergewaltigten Frauen in Deutschland mit 860.000 an. Ihre auf der Basis der ebenfalls nur geschätzten Zahl der sogenannten Besatzungskinder hochgerechneten Opferzahlen legten dann nahe, daß annähernd 190.000 in der Bundesrepublik lebende Frauen amerikanischen Tätern zum Opfer gefallen seien, 50.000 Frauen französischen Tätern, 45.000 britischen, 15.000 sowjetischen und 10.000 belgischen. Gebhardt zitiert allerdings auch andere Schätzungen, so von Helke Sander und Gerhard Reichling, wonach die Zahl der Vergewaltigungen auf rund 110.000 Fälle allein in Berlin und weitere 1,9 Millionen Fälle in der SBZ, in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und während Flucht und Vertreibung geschätzt würden. Somit wären 2 Millionen deutsche Frauen einer kriegsbedingten Vergewaltigung durch Sowjets zum Opfer gefallen. Ingo von Münch gibt Schätzungen verschiedener Autoren wieder, die von 1.400.000-2.000.000 Opfern ausgehen. Aber nicht nur die im Vergleich zu anderen Untersuchungen auffallend niedrige Gesamtzahl von 860.000 Opfern fällt auf, sondern auch die in sich nicht stimmige Verteilung auf die Tätergruppen. Denn die Addition der genannten Zuordnungszahlen ergibt nun einmal 310.000 und nicht 860.000. Falls die Angaben zu den Tätern aus den westalliierten Armeen zutreffen sollten, dann müßten nicht 15.000, sondern 565.000 Frauen den Übergriffen der sowjetischen Soldaten zum Opfer gefallen sein.
Im Schwerpunkt befaßt sich die Verfasserin mit den Motiven der Täter einerseits und den Auswirkungen ihrer Taten auf die Opfer andererseits. Die Motive der Täter sucht sie offenbar vorwiegend in den Kriegserlebnissen der Soldaten, ihrer Wahrnehmung des Feindes, und zwar nicht nur des feindlichen Soldaten, sondern des feindlichen Volkes überhaupt, so wie in kulturellen und psychischen Ursachen wie dem Verhältnis der Geschlechter, gruppendynamischen Prozessen und ähnlichem mehr. Erwähnt wird auch die Propaganda, gerade auf sowjetischer Seite. Auch wenn sie ausführt, das „berühmte“ Flugblatt, in dem der Schriftsteller Ilja Ehrenburg zur massenhaften Vergewaltigung und Schändung deutscher Frauen aufruft, werde ihm nur zugeschrieben, so macht es doch wohl keinen Unterschied, ob es von ihm oder einer unbekannten Person verfasst worden ist. Nachweislich wurde es in der Roten Armee verbreitet. Und sein Text ist an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten: „Tötet. Es gibt nichts, was an den Deutschen unschuldig ist, die Lebenden nicht und die Ungeborenen nicht. Folgt der Weisung des Genossen Stalin und zerstampft für immer das faschistische Tier in seiner Höhle. Brecht mit Gewalt den Rassenhochmut der germanischen Frauen! Nehmt sie als rechtmäßige Beute! Tötet, ihr tapferen Soldaten der siegreichen sowjetischen Armee!“
Damit ist aber auch klar, warum die Rote Armee wenn überhaupt, nur sehr selten gegen Vergewaltigungen eingeschritten ist. Auch wenn sogar in Einzelfällen Soldaten wegen solcher Taten zum Tode verurteilt und hingerichtet worden sind, so haben es die Kommandeure und Befehlshaber mindestens geduldet, daß ihre Soldaten sich so verhalten haben. Anders wäre es ja auch nicht möglich gewesen, daß dies in so ungeheurem Ausmaß geschehen konnte.
Der Verdienst der Arbeit liegt sicher darin, daß die ebenfalls objektiv sehr große Zahl von Vergewaltigungen durch amerikanische, britische und französische sowie auch belgische Soldaten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Auch hier fällt auf, daß die Offiziere nur sehr selten gegen diese Täter eingeschritten sind. Natürlich sind auch Strafverfahren vor Kriegsgerichten durchgeführt worden, insbesondere in der US-Armee. Deren Zahl ist zwar nicht exakt belegt, und kann deswegen auch nur vorsichtig geschätzt werden. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Taten ist sie verschwindend gering. Auch dies mag daran liegen, daß auch den Soldaten der westlichen Alliierten die Frauen des besiegten Feindes und sogar der befreiten europäischen Länder (Frankreich, Italien) gewissermaßen als Beute versprochen wurden. Traurige Berühmtheit haben die Massenvergewaltigungen durch nordafrikanische Soldaten der französischen Armee in Italien erlangt. Der Kommandierende General des französischen Expeditionskorps hatte seine Soldaten für den verlustreichen Durchbruch durch die deutsche Gustav-Linie bei Monte Cassino motiviert, indem er ihnen erklärte, die Frauen in den Dörfern jenseits der Front gehörten für die nächsten drei Tage ihnen. Gebhardt schreibt: „Wie wir mittlerweile wissen, war die Kriegsprämie in Gestalt einer europäischen Frau durchaus ein Rekrutierungsargument der US Armee gewesen.“ Unter diesen Umständen nimmt es nicht wunder, daß die Armeeführungen weder disziplinarisch noch kriegsgerichtlich in nennenswertem Umfang gegen diese Täter eingeschritten sind. Inwieweit auch die diffamierende Kriegspropaganda gegen die Deutschen an sich und nicht lediglich gegen die Nationalsozialisten hier mitgespielt hat, untersucht die Verfasserin leider nicht.
Was an dem Buch von Miriam Gebhardt jedoch besonders ins Auge fällt, ist ihr Erklärungsmuster, wonach die Opfer dieser Untaten gewissermaßen objektiv durch ihre Unterstützung des Nazi-Regimes eine Ursache für ihr späteres Schicksal gesetzt hätten. So findet sich gleich im Vorwort der an sich unglaubliche Satz: „Vielmehr sollen die Opfer selbst zu Wort kommen, sie sollen rehabilitiert werden, ohne daß sie damit zugleich von den deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus freigesprochen sind. Es erscheint mir wichtig, diese Ambiguität der Täter-und Opferrolle anzuerkennen.“ Mit diesem Ansatz steht sie offenbar nicht alleine. Sie weist darauf hin, daß es sich eingebürgert habe, daß die wenigen „Historikerinnen und Historiker“, die das Thema Massenvergewaltigungen an deutschen Frauen überhaupt beschäftigt, ihren Ausführungen lange Exkurse über die Verbrechen der Wehrmacht, die Wehrmachtbordelle und die Zwangsprostitution in Konzentrationslagern voranstellen. Erst wenn von den eigenen Untaten ausführlich gesprochen worden sei, dürfe von den eigenen Opfern die Rede sein. Diese Rhetorik sei verständlich und sympathisch, allerdings lege sie ihres Erachtens eine problematische Kausalität nahe – weil die Deutschen so unendlich gewütet haben, wurden die deutschen Frauen anschließend vergewaltigt. Diese innere Logik trifft für sie allerdings für amerikanische und kanadische Soldaten nicht zu, weil die Wehrmachtssoldaten nicht zuvor den Frauen jenseits des Atlantiks sexuelle Gewalt angetan hätten. An dieser Stelle ist bemerkenswert, worüber die Verfasserin schweigt. Sie setzt stillschweigend voraus, daß die deutschen Soldaten während des Krieges ebenfalls massenhaft derartige Verbrechen begangen hätten. Dem war aber nicht so, was die Verfasserin eigentlich wissen müßte. Ingo von Münch zitiert in seinem bereits 2009 erschienenen Werk die Arbeit von Birgit Beck, „Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Sexualverbrechen vor deutschen Militärgerichten 1939-1945“, die bereits 2004 erschienen ist. Er zitiert auch das ebenfalls von Gebhardt ausgewertete Werk von Helke Sander/Barbara Johr, woraus sich ergibt, daß „Ereignisse wie in Nanking oder in Berlin für die Wehrmacht nicht belegt“ sind. Von Münch zieht daraus den Schluß, daß dies konkret und eindeutig bedeutet, daß es keine – den Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch russische Soldaten 1944/1945 vergleichbaren – Massenvergewaltigungen durch deutsche Soldaten gegeben hat, übrigens auch keine sogenannten systematischen Vergewaltigungen, die entweder Terror verbreiten sollten, oder wie im Bosnien-Krieg von serbischer Seite, mit dem Ziel der „ethnischen Säuberung“ im Zusammenhang standen. Vielmehr weist von Münch darauf hin, daß die Wehrmacht vor allem aus Gründen der Disziplin gegen Vergewaltigungen auch in Russland regelmäßig und auch mit drakonischen Strafen eingeschritten ist. Dies habe im übrigen sogar für die Waffen-SS gegolten. Tatsächlich sind von den Wehrmachtgerichten eine Vielzahl von Soldaten wegen solcher Verbrechen sogar mit dem Tode bestraft worden. Gebhardt hätte somit Gelegenheit gehabt, das Rachemotiv, das den Soldaten der Roten Armee nicht selten mit einem gewissen Verständnis unterstellt wird, in das Reich der Fabel zu verweisen. Daß sie es nicht tut, und die Arbeiten von Beck und von Münch nicht einmal erwähnt, läßt nur die Schlussfolgerung zu, daß auch sie an dem Bild von den marodierenden und vergewaltigenden Wehrmachtssoldaten festhalten will. Entgegenstehende Fakten werden dann lieber erst gar nicht erwähnt.
Empörend ist jedoch die Auffassung der Verfasserin, die vergewaltigten Frauen und Kinder (!) hätten gewissermaßen objektiv eine Ursache dafür gesetzt, daß die alliierten Soldaten so mit ihnen umgegangen seien. Sie behauptet wörtlich: „Seit den neunziger Jahren ist es kein Geheimnis mehr, daß deutsche Frauen und Kinder nicht nur Opfer waren. Sie haben mehrheitlich der nationalsozialistischen Ideologie zugestimmt, sie waren im schlimmsten Fall aktiv an der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik beteiligt. Ohne die zahllosen Denunziantinnen wäre etwa die Erfassung der jüdischen Bevölkerung zur späteren Ausplünderung, Vertreibung und Vernichtung nicht möglich gewesen. Die Annahme, daß deutsche Frauen überlebenswichtig seien für die ‚arische‘ Rasse, ließen sie die sogenannten minderwertigen Frauen und Völker spüren. Frauen waren KZ-Wärterinnen, Kolonistinnen in den besetzten Gebieten, Anstifterinnen, Mitläuferinnen, Profiteurinnen oder zumindest Zuschauerinnen der nationalsozialistischen Verbrechen…. Auch vermeintlich apolitische Hausfrauen glaubten an die Überlegenheit des deutschen Volkes und an die Gerechtigkeit des Krieges, hofften auf den Endsieg und hielten ganz entscheidend die Kriegsmaschinerie am Laufen… Frauen waren zu jener Zeit von der Abhärtungsideologie, von der Notwendigkeit von Sachlichkeit und Empathielosigkeit genauso überzeugt wie Männer, sie haben ihre Kinder entsprechend erzogen. Wir müssen davon ausgehen, daß eine deutsche Durchschnittsfrau von den nationalsozialistischen Verbrechen wie dem Judenmord und den Greueltaten der Wehrmacht wissen konnte… Es ist vollkommen klar, daß viele Vergewaltigungsopfer mindestens potenziell auch Täterinnen waren. Selbst Kinder waren nicht immer nur unschuldig, sondern haben sich unter Umständen an Schikanen von Zwangsarbeitern beteiligt, jüdische Mitschüler gemobbt und sich für Angehörige einer Herrenrasse gehalten.“ Die Verfasserin behauptet also allen Ernstes, die Frauen und Kinder jener Zeit hätten nicht einfach wie Frauen und Kinder in allen anderen kriegführenden Ländern sich um ihre Ehemänner, Söhne bzw. Väter gesorgt, sondern aktiv nicht lediglich ihr Land, sondern die nationalsozialistische Ideologie unterstützt. Sogar Kindern eine bewußte Unterstützung des Regimes zu unterstellen, verschlägt einem schon den Atem. Natürlich liegt Gebhardt damit auf einer Linie mit dem Bundespräsidenten Gauck, der den hunderttausenden von Opfern des alliierten Bombenterrors bescheinigt hat, sie hätten angesichts des Leides, das die Deutschen über Europa gebracht hätten, indem sie jenen Krieg vom Zaun gebrochen und in verbrecherischer Weise geführt hätten, eigentlich erwarten müssen, daß ihnen derartiges geschieht. Es ist müßig, darauf hinzuweisen, daß selbst die Minderheit der Wähler, die Hitler in freien Wahlen ihre Stimme gegeben haben, zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, was Jahre später geschehen würde, und daß die allermeisten Deutschen auch während des Krieges wegen der strikten Geheimhaltungsmaßnahmen des Regimes von seinen großen Untaten nichts gewußt haben. Es ist bedrückend, daß eine deutsche Hochschullehrerin einen solchen Ursachenzusammenhang nicht für völlig abwegig und unhistorisch erklärt, sondern diesen Zusammenhang lediglich nicht für eine ausreichende Erklärung hält, sondern, so wörtlich: „Eine empathische Auseinandersetzung mit der Massenvergewaltigung sollte vielmehr unter dem Vorzeichen der Verklammerung der beiden Kategorien Geschlecht und Ethnie stehen.“ Da hilft es wenig, daß sie immerhin in rechtlicher Hinsicht ausführt, es gebe generell keine Legitimation eines Verbrechens aus einem anderen Verbrechen. Denn auch diese Argumentation fußt auf der Grundannahme, daß es gleichartige Verbrechen auf der Seite der Opfer gegeben hat.
Die Autorin hat auch offenbar erhebliche Vorbehalte gegen die Vorstellungen der Deutschen in der Kriegs-und Nachkriegszeit über das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Deswegen setzt sie sich auch entsprechend kritisch mit dem Umgang der deutschen Gesellschaft mit den Opfern dieser massenhaften Vergewaltigungen auseinander. Tatsache ist jedoch, daß es zwar leider vielfach nicht gelungen ist, den Opfern wenigstens Entschädigung zu gewähren, von Gerechtigkeit und Genugtuung ganz zu schweigen. Alles jedoch auf Gesellschaftsordnung jener Zeit zurückzuführen, halte ich für unzulässig.
Ingo von Münch beschränkt sich auf die Vorgänge im Osten, wie ausgeführt. Diese untersucht er sorgfältig und faktenreich. Ebenso wie Gebhardt zitiert er in großem Umfang die Aussagen von Opfern. Die Lektüre dieser Erzählungen ist bedrückend. Dennoch muß man sie lesen um einen Eindruck davon zu bekommen, was damals geschehen ist. Von Münch sieht die Ursache für dieses Verhalten der sowjetischen Soldaten meines Erachtens zutreffend einerseits in der Hasspropaganda des Regimes und andererseits in der Tat in der Psyche der Soldaten. Gebhardt indessen meint, lange Zeit, vielleicht bis heute, habe die „Karikatur des barbarisch vergewaltigenden Russen“ das Geschichtsbild hierzulande beherrscht. Dieses Zerrbild bündelte all die historisch angestauten Ressentiments und Befürchtungen der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Bolschewismus und den im Nationalsozialismus herabgewürdigten „Untermenschen“ aus dem Osten. Die Massenvergewaltigungen hätten dieses Bild bestätigt. Leider muß man sagen: Sie haben es bestätigt. Ähnliches muß auch für das Verhalten der nordafrikanischen Soldaten in der französischen Armee gesagt werden. Denn ihr Anteil an diesen Verbrechen ist überwältigend. Offenbar hat man jedoch Angst, sich dem Vorwurf des Rassismus auszusetzen, wenn man diese Fakten benennt. Es geht jedoch nicht an, Tatsachen auszublenden, nur weil sie geeignet sein könnten, Vorurteile zu schüren.
Zusammenfassend muß festgehalten werden, daß die Arbeit von Miriam Gebhardt sich nahtlos in die lange Reihe von Büchern einfügt, die den Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus allgemein und ihren Soldaten im besonderen eine grundsätzliche Übereinstimmung mit dem System bescheinigen. Sie haben demnach alle Verbrechen des Systems mit zu verantworten. Sie können sich deswegen nicht darüber beschweren, daß sie selbst Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind. Somit waren sie Täter und Opfer zugleich. Wir Nachgeborenen müssen nach ihrer Ansicht 70 Jahre nach Kriegsende so viel Ambiguitätstoleranz eben aufbringen. In diesem Zusammenhang scheint ihre größte Sorge zu sein, daß die Schilderung jener Greueltaten der alliierten Soldaten in Ost und West den sogenannten Revisionismus fördern könnte. Nüchterne wissenschaftliche Arbeit ebenso wie Empathie mit den Opfern sieht anders aus. Daß ein angesehener Lehrer des Staats- und Völkerrechts wie Ingo von Münch erst gar nicht erwähnt wird, könnte zu Spekulationen darüber Anlaß geben, daß manche Historiker wohl den juristischen Zugang zur Geschichte fürchten.