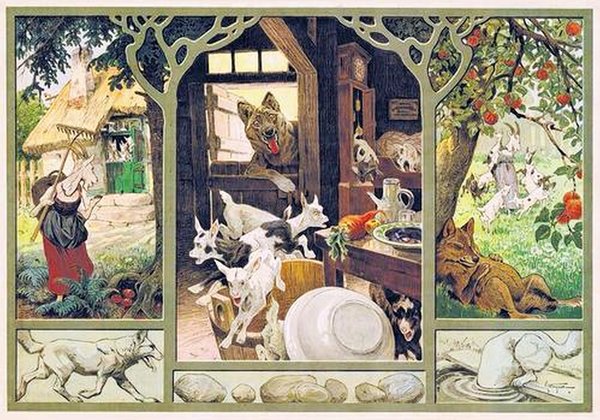Der Medienkonsument kann dem Thema kaum noch ausweichen. Ob jemand gerade mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird, oder als Fußballfachmann vorgestellt wird: Fachkunde und Preiswürdigkeit scheinen nicht zu genügen. Es muß wohl, soweit zutreffend, auch von seiner/ihrer Homosexualität gesprochen werden. Als ob das im Zusammenhang mit dem jeweiligen Thema tatsächlich die Leute interessieren würde. Natürlich interessiert es eigentlich genauso wenig, wie die bevorzugte Automarke eines Literaten oder die abendliche Lektüre des Fußballfachmannes. Offenbar besteht jedoch ein erhebliches Interesse bestimmter Kreise daran, das Thema stets am köcheln zu halten, mehr noch, Sexualität allgemein und Homosexualität im besonderen in der öffentlichen Diskussion zu halten. Der Mensch als sexuelles Wesen scheint ihnen gesellschaftspolitisch ein wichtiges Projekt zu sein. Deswegen die sog. Genderwissenschaften und die Vorstellung aller möglichen sexuellen Erscheinungsformen schon in der Grundschule.
Doch was zu viel ist, ist einfach zu viel.
Es ist sicher ein gesellschaftlicher und humanitärer Gewinn, daß in unserer Kultur, ich betone in unserer Kultur, sexuell abweichendes Verhalten von Erwachsenen untereinander nicht mehr strafbar ist. Wir halten es heute mit Recht für normal, daß dies nun einmal Privatsache ist. Und das sollte sie auch wirklich sein. Die Minderheit von 1% bis 2 % von Menschen, deren sexuelle Veranlagung sie auf das jeweils eigene Geschlecht fixiert, und ihnen damit ein Familienleben, das den anderen 98-99 % möglich ist, unmöglich macht, wird von ihren selbst ernannten Funktionären und Interessenvertretern jedoch derart in den Vordergrund geschoben, daß man meinen könnte, ein bedeutender Prozentsatz der Bevölkerung sei so veranlagt. Und deswegen müssten sie natürlich in jeder Hinsicht nicht nur gleichberechtigt sein, vielmehr ihre von der Natur erzwungene Art zu leben sei dasselbe, wie das Leben der anderen. Es ist eben nicht dasselbe. Das ist keine Abwertung. Das ist einfach die Feststellung: er/sie ist anders. Dabei kann man es belassen. Wenn eben zwei Menschen keine gemeinsamen Kinder bekommen, und gemeinsam in Liebe großziehen können, dann sollen sie eben halt nicht krampfhaft das äußere Bild einer Familie darstellen wollen, die eben tatsächlich aus biologischen Gründen nicht existiert. Dann lebt man eben nicht in der Familie, was im übrigen auch viele Menschen tun, die es biologisch durchaus könnten.
Man muß eben nicht ständig andere Menschen mit diesen intimen Dingen belästigen. Mir ist es wirklich vollkommen gleichgültig, ob jemand, mit dem ich nun beruflich oder gesellschaftlich zu tun habe, in seinem Privatleben glücklich verheiratet ist und mit seiner Frau die gemeinsamen Kinder großzieht, oder eben nicht, und vor allem interessiert mich dann nicht, warum. Dieser Mensch interessiert mich eben als Mandant oder Zeuge oder vielleicht auch Kollege, privat indessen überhaupt nicht. Und das gleiche gilt für Menschen, die mir in den Medien als dies oder jenes vorgestellt werden. Wenn aber dann mit einer gewissen Penetranz noch irgendetwas „von seiner Homosexualität“ erzählt wird, dann denke ich mir regelmäßig, daß ich das eigentlich nicht hören wollte. Durchaus anders ist es allerdings, wenn aus einem sachlichen Grund über das Familienleben eines Menschen berichtet wird. Abgesehen davon, daß dies tatsächlich im Sinne der Gauß’schen Normalverteilung das ist, was man von den meisten Menschen erwarten kann, ist das ja schließlich auch ein Thema von gesellschaftlicher Bedeutung. Das ist so banal, daß jedes weitere Wort darüber überflüssig wäre.
Ich glaube im übrigen nicht, daß diese maßlose Überhebung dem berechtigten Anliegen der so veranlagten Menschen dienlich sein kann. Vielmehr kann das Gefühl der Belästigung dazu führen, daß man berechtigte Anliegen vielleicht auch einmal unberücksichtigt läßt. Übertreibungen sind nie gut. So richtig es war, den § 175 StGB aufzuheben, so fragwürdig ist es, ein Vierteljahrhundert später zu fordern, daß die seinerzeit auf dieser Rechtsgrundlage verurteilten Menschen per Gesetz gewissermaßen nachträglich freigesprochen werden und eine finanzielle Entschädigung erhalten. Denn die ersatzlose Streichung eines Gesetzes ist im Grunde Rehabilitation. Der Gesetzgeber signalisiert damit klar und deutlich, daß sich nun die bessere Erkenntnis Bahn gebrochen hat. Eine ausdrückliche gesetzliche Rehabilitierung mit Entschädigungsregelung indessen würde ja bedeuten, daß der damals allgemein für richtig gehaltene Rechtszustand auch damals Unrecht gewesen wäre. Das war er nicht. Nicht einmal unter der Geltung unseres Grundgesetzes. Es ist ja auch noch niemand auf den Gedanken gekommen, nach der Aufhebung anderer Straftatbestände, etwa der früheren generellen Strafbarkeit der Abtreibung ein Rehabilitationsgesetz mit Entschädigungsregelung zu fordern, oder, um eine weniger bedeutsame Vorschrift zu nennen, nach der Aufhebung von § 143 StGB, Halten von und Handel mit gefährlichen Hunden, gleiches zu tun.
Man belästige uns also bitte nicht mehr auf Schritt und Tritt mit dem Privatleben anderer Leute. Vor allem aber behellige man nicht Kinder, denen Sexualität an sich noch völlig fremd ist, mit Dingen, mit denen selbst die meisten Erwachsenen nicht behelligt werden möchten.
Der Umgang mit diesem Thema ist auch ein Prüfstein für die Seriosität von politischen Parteien. Wer das plakative Zurschaustellen von allerlei sexuellen Varianten und die Indoktrination von Schulkindern durch Aktivisten von Lesben- und Schwulenverbänden so offensichtlich zum politischen Schwerpunkt macht, daß Koalitionsvereinbarungen ohne dem nicht mehr denkbar erscheinen, wie das bei den Grünen der Fall ist, dem sollten die Wähler doch die kalte Schulter zeigen.