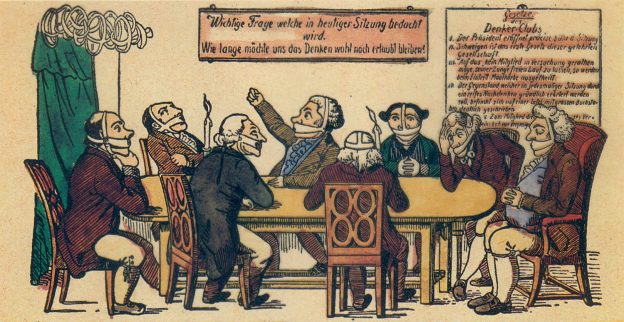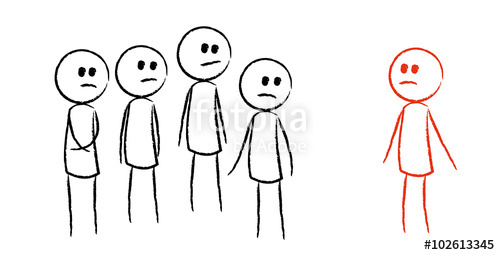Der damalige Bundespräsident Christian Wulff hat in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2010 eine Debatte angestoßen, die bis heute nicht verstummt ist, vielmehr durch die Flüchtlingskrise seit September 2015 noch mehr an Fahrt aufgenommen hat. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die geistig-kulturelle Prägung Deutschlands. Wulff sagte damals unter anderem:
„Das Christentum gehört zweifellos zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“
Seither werden Politiker und Publizisten in Deutschland nicht müde, Gedanken oder auch nur Phrasen über die kulturelle Prägung unseres Landes durch die drei großen Buchreligionen Judentum, Christentum und Islam unters Volk zu bringen. Einigkeit scheint darin zu bestehen, daß die abendländische und damit auch die deutsche Kultur wesentlich christlich-jüdisch geprägt sei. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte beispielsweise am 8. September 2017, daß die abendländische Kultur mit ihren Wurzeln im Christentum und Judentum natürlich weiterhin für unser Land bestimmend bleibe. Unüberhörbar hat sie aber auch mehrmals die Auffassung Wullfs bestätigt, daß der Islam zu Deutschland gehöre. Die Formel von der christlich-jüdischen Prägung unserer Kultur, wahlweise auch unserer Tradition, scheint allgemein konsensfähig zu sein.
Nun kann von der Zugehörigkeit einer Religion zu einem Volk in diesem Sinne nur dann gesprochen werden, wenn sie tatsächlich eine identitätsstiftende Funktion hat. Was den Islam angeht, so wollen wir das an dieser Stelle nicht näher untersuchen. Denn es scheint doch ganz offensichtlich zu sein, daß der Islam in diesem Sinne nicht zu Deutschland gehört, und zwar nicht nur wegen des zeitlichen Zusammenhanges. Eine nennenswerte Zahl von Bürgern dieses Landes mit islamischer Konfession gibt es ja überhaupt erst seit knapp 50 Jahren. Über die Unvereinbarkeit dieser Religion mit tragenden Grundsätzen unserer Verfassung wie auch der Alltagskultur in Deutschland muß hier nichts mehr gesagt werden.
Inwieweit haben Christentum und Judentum Deutschland geistig-kulturell geprägt?
Im folgenden wollen wir untersuchen, inwieweit Christentum und Judentum Deutschland geistig-kulturell geprägt haben. Hinsichtlich des Christentums kann man sich darauf beschränken, daß es unübersehbar das Gesicht Deutschlands prägt. Die Unzahl von Kirchen und Klöstern, die Kreuze auf Berggipfeln und an den Bändern der Kriegs- und Verdienstorden, die Präambeln des Grundgesetzes und einiger Landesverfassungen, die ausschließlich christlichen Feiertage neben den staatlichen Gedenktagen im Kalender, die traditionell überwiegend christlichen Vornamen der Deutschen, die Kreuze in den Schul- und Gerichtssälen und vor allem der statistisch ermittelte Bevölkerungsanteil der Religionsangehörigen in unserem Lande sprechen eine eindeutige Sprache. Von den 82,67 Millionen Menschen, die im Jahr 2016 in Deutschland gemeldet waren, hatten etwa 9,2 Millionen keinen deutschen Pass, jedoch ihren ständigen Wohnsitz in unserem Land. Auch deren Religionszugehörigkeit ist sehr unterschiedlich. Die meisten bekennen sich wohl zum Islam, jedoch finden sich auch nicht wenige Christen darunter, etwa Italiener, Polen, Spanier, Russen etc. Von der Gesamtbevölkerung waren 2016 nach den Meldeamtsregistern 28,52 % römisch-katholisch, 26,52 % evangelisch, 5,14 % muslimisch und 0,12 % jüdischen Glaubens. Diese Zahlen sprechen für sich. Die Frage, inwieweit das Christentum Deutschland prägt, muß daher nicht weiter vertieft werden. Es genügt darauf hinzuweisen, daß nicht nur die Gegenwart, sondern vor allem die Geschichte Deutschlands wie auch der übrigen europäischen Länder vom Christentum nachhaltig geprägt ist.
Weil die Formel von der christlich-jüdischen Prägung Deutschlands sprachlich eine Gleichgewichtigkeit herstellt, die angesichts der auch ganz allgemein bekannten Geschichte des Judentums in Deutschland, nicht nur in Ansehung der nahezu vollständigen Vernichtung der Juden in Deutschland während der nationalsozialistischen Diktatur, zumindest nicht plausibel erscheint, wollen wir näher betrachten, inwieweit auch das Judentum Deutschland geprägt hat und vielleicht noch heute prägt.
Geschichte der Juden in Deutschland
Von Deutschland im staatsrechtlichen Sinne sprechen wir frühestens seit Heinrich I, im Jahre 919 n. Chr. von den deutschen Herzögen zum König gewählt. Auf jeden Fall seit 962 n. Chr., als Otto der Große auch die Kaiserwürde des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation erlangte. Die Geschichte der Juden in Deutschland ist allerdings schon sehr viel älter. Sie begann mit der Beendigung jüdischer Staatlichkeit in Palästina, nachdem die bloße Eroberung des Landes und Einsetzung von der römischen Besatzungsmacht abhängiger Könige die Pax Romana in dieser Region nicht gewährleisten konnte. Diverse Aufstände der Bevölkerung bewogen Kaiser Nero, die syrische Provinz endgültig zu befrieden. Mit der Führung des Feldzuges wurde der spätere Kaiser Titus beauftragt. Im Jahre 70 n. Chr. eroberte er Jerusalem, ließ ein Blutbad unter der Bevölkerung anrichten und den Tempel zerstören. Von seinem Triumphzug kündet noch heute ein Relief auf dem Titusbogen in Rom, auf dem unter der mitgeführten Beute auch der siebenarmige Leuchter des Tempels zu erkennen ist. Versprengte Reste des jüdischen Volkes sammelten sich im Exil um den Ort Iamnia. Unter der Führung des Fürsten Simon Bar Kochba erhoben sie sich 60 Jahre später erneut. Sie erzielten auch zunächst militärische Erfolge und proklamierten die Befreiung Israels. Doch dauerte es nicht lange, bis das römische Heer zuschlug, 135 n. Chr. unter Kaiser Hadrian die Aufstandsbewegung niederwarf und die Männer Bar Kochbas niedermachte und versprengte. Von ihren letzten Tagen künden die am Toten Meer aufgefundenen Texte. Jerusalem wurde zur römischen Garnisonsstadt Aelia Capitolina erklärt, Juden durften sie nicht betreten. Die Bevölkerung wurde bis auf wenige Tausend vertrieben und ging in die Diaspora. Die Römer nannten die Provinz fortan Syria Palestina. Mit der Zerstörung des kultischen Zentrums der Jerusalemer Kultusgemeinde war dem alten Israel, wie es auch in der nachexilischen Kultusgemeinde noch lebendig geblieben war, das Fundament genommen. In Iamnia wurden die heiligen Schriften in einem endgültigen Kanon erfaßt, und von hier aus nahm die Geschichte des nachbiblischen Judentums ihren Ausgang: eine Geschichte der Zerstreuungen, Wanderungen, Sammlungen und unendlichen Leiden in der Fremde.
Die Juden wurden in der Diaspora weit über Vorderasien, Nordafrika und Europa verstreut. Ein Dasein in der Diaspora hatten sie allerdings auch schon früher zu fristen. Die babylonische Gefangenschaft ist sprichwörtlich ebenso wie das Zwangsexil in Ägypten. Beide Ereignisse haben auch die Phantasie der Künstler angeregt. Beispielhaft sei auf Verdis „Nabucco“ hingewiesen. In Deutschland, das wir auch schon lange vor Beginn seiner Staatlichkeit im 10. Jahrhundert n. Chr. so nennen, finden wir bereits in römischer Zeit jüdische Gemeinden. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die römischen Städte an Rhein und Mosel sowie in Süddeutschland – Köln, Xanten, Bonn, Trier und Augsburg – waren neben ihren administrativen Funktionen auch Garnisonen der römischen Legionen und ihrer Hilfstruppen sowie Zentren von Handel und Gewerbe. Schon in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus finden sich dort Hinweise auf jüdische Gemeinden. Sichere Zeugnisse haben wir zum Beispiel in Gestalt einer tönernen Öllampe, die man in Trier gefunden hat und auf das 4. Jahrhundert n. Chr. datiert. Sie zeigt das Abbild eines siebenarmigen Leuchters. Zwei Dekrete Konstantins des Großen vom 11. Dezember 321 und vom 1. Dezember 331 richten sich an eine damals offenbar recht große und alte Gemeinde in Köln. Ausdrücklich erwähnt darin der Kaiser auch den Rabbiner und die Väter der Synagoge.
Somit können die Anfänge der Geschichte der Juden in Deutschland in die beiden ersten Jahrhunderte nach Christus datiert werden, auch wenn die Zeugnisse dafür spärlich sind. Wie so häufig in der Geschichte, changieren hier Mythos und Fakten. Als Gründungsmythos des jüdischen Lebens in Deutschland gilt die Erzählung, wonach der Jude Kalonymos Kaiser Otto II. (973-983) in der Schlacht bei Cotrone 982 das Leben gerettet haben soll. Der dankbare Kaiser habe dann ihn und seine Familie nach Deutschland mitgenommen. Nun gibt es in der Tat auch einen handfesten Hinweis auf diese Familie, nämlich den Grabstein eines Nachfahren eben jenes Kalonymos auf dem jüdischen Friedhof in Mainz, der von 1020 datiert. Tatsächlich siedelten sich jüdische Gemeinden an den Bischofssitzen an, weil die Bischöfe die Ansiedlung jüdischer Kaufleute zur Hebung der Wirtschaftskraft ihrer Territorien gerne sahen. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die mittelalterliche Gesellschaft, die eine streng regulierte Standesgesellschaft war. Die Berufe der Kaufleute und Handwerker (Zünfte!) waren ebenso reglementiert wie die gesellschaftlich weniger angesehenen Tätigkeiten der Bader und Wundheiler, oder gar des Henkers, obgleich man dessen Dienste gerne auf ganz anderem Felde in Anspruch nahm, nämlich auf medizinischem Gebiet. Die Juden erhielten eben von ihren Schutzherren Privilegien, die sie weitgehend mit den christlichen Untertanen des jeweiligen Fürsten gleichstellten. Volles Bürgerrecht hatten sie indessen nicht. Die Privilegien berechtigten zur Ausübung von Berufen wie dem des Kaufmanns oder auch des Geldverleihers. Schutz bot indessen nur der Kaiser oder der bischöfliche Herr. So wie sie sich absonderten und nur in ihrer Gemeinde nach ihren Gesetzen und Bräuchen lebten, mieden aber auch die Christen den Umgang mit ihnen. Diese Koexistenz war naturgemäß fragil, was sich später immer wieder bei den Pogromen zeigte. Darauf werden wir noch eingehen.
Das Leben der Juden in der Diaspora war fortan vor allem dadurch gekennzeichnet, daß sie überall eine ethnische, gesellschaftliche und religiöse Minderheit bildeten. Nur vereinzelt assimilierten sie sich und gingen in der Mehrheitsbevölkerung des jeweiligen Landes auf. Dieses Phänomen existiert bis heute, ungeachtet dessen, daß die Juden rund 1900 Jahre nach der Zerstörung des Tempels und der Vertreibung aus ihrem Lande im Jahre 1948 mit der Gründung des Staates Israel ihre historische Heimstatt wiedergefunden haben. Es ist daher zu untersuchen, wie es dazu kommen konnte, daß sich ein Volk ohne eigenen Staat über viele Jahrhunderte erfolgreich seine Identität bewahren konnte.
Nationale und religiöse Exklusivität
Sucht man nach Unterscheidungsmerkmalen, so stößt man rasch auf den Umstand, daß im Falle der Juden von Anbeginn an Volkstum und Religion eine Einheit bilden. Keine der übrigen großen Religionsgemeinschaften ist ausdrücklich auf die Angehörigen eines Volkes, und zwar explizit in Form der Abstammungsgemeinschaft, beschränkt. Wenn auch zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus im wesentlichen Religionen ostasiatischer Völker sind, so sind sie doch für Angehörige anderer Völker offen, obwohl sie nicht aggressiv, genau genommen überhaupt nicht, missionieren. Der Islam versteht sich von Anbeginn an als Religion für alle Völker, die sich ihm auch zu unterwerfen haben. Erst dann kann nach der Lehre des Korans der Friede auf dieser Erde einkehren (Suren 9, 5, 29 und 10, 25). Das Christentum versteht sich ebenfalls von Anfang an als Religion für die Völker dieser Erde. „Gehet hin und lehret die Völker!“ (Mt 28, 19; Mk 16, 15) lautet das Missionsgebot Jesu Christi, auch wenn die Nachfolger seiner Apostel in unseren Tagen, vor allem soweit ihre Muttersprache Deutsch ist, dies in Vergessenheit geraten lassen. So findet eine Missionsarbeit bei den Muslimen im deutschsprachigen Raum nicht statt.
Diese Besonderheit des Judentums zeigt sich grundsätzlich daran, daß man sich nach der religiösen Überlieferung als das auserwählte Volk Gottes betrachtet. Im 5. Buch Mose, Kap. 7, 6 heißt es ja: „Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind.“ Der exklusive Bund zwischen Gott und seinem auserwählten Volk wird ausdrücklich bei Josua 24 beschrieben. Der Chronist läßt Gott den Juden vorhalten, daß er sie aus der ägyptischen Knechtschaft gerettet hat und sie auffordern, ihm deswegen treulich zu dienen und keine anderen Götter anzubeten. Vielfältige Zeichen dieser Exklusivität finden sich überall im Alten Testament. Natürlich ist auch die Übergabe der Tafel mit den Zehn Geboten an Moses auf dem Berg Sinai ein solches Zeichen. Denn wie anders soll es zu verstehen sein, daß Gott selbst dem Moses seine Gebote ausgehändigt hat. Unterstrichen wird dies durch strenge religiöse Gesetze, die es gewährleisten, daß sich die Angehörigen dieser Religion und gleichzeitig dieses Volkes von allen anderen Glaubensgemeinschaften und Nationen nachhaltig unterscheiden.
In diesen Zusammenhang gehört auch die Beschneidung der männlichen Neugeborenen. Diese Vorschrift ist eindeutig. 1 Mose 17, 10-14 läßt Gott zu Abraham sprechen: „Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt aber die Vorhaut von eurem Fleisch beschneiden. Das soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Ein jegliches Knäblein, wenn es acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Beschnitten werden soll alles Gesinde, das dir daheim geboren oder erkauft ist. Und also soll mein Bund an eurem Fleisch sein zum ewigen Bund. Und wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum, daß es meinen Bund unterlassen hat.“
Der Abschottung gegen andere Völker dient auch das Verbot der Mischehe, also der Eheschließung zwischen Juden und Andersgläubigen. Nicht nur, daß Jude nur sein kann, wer von einer jüdischen Mutter geboren worden ist. Für den gläubigen Juden führt die Eheschließung mit einer nicht seiner Religion angehörigen Frau auch dazu, daß er den Zugang zur jenseitigen Welt verliert. Dieses Verbot ist schon in 5. Mose 7, 3-4 statuiert. „Und du sollst dich nicht mit ihm verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben, und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, daß er anderen Göttern dient, und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen, und er würde dich schnell vernichten.“ Dennoch wurde dieses Gebot bis zur babylonischen Gefangenschaft liberal gehandhabt. Danach erfuhr die Einstellung zur Mischehe eine grundsätzliche Änderung, weil sie bis dahin in so großer Zahl abgeschlossen wurde, daß die Erhaltung der jüdischen Gemeinschaft bedroht schien. Esra ergriff daher die strengsten Maßnahmen gegen die ohne vorangegangenen Übertritt zum Judentum eingegangene Mischehe, ließ die Auflösung sämtlicher Mischehen beschließen und die fremden Frauen wegschicken. Diese Maßregel fand zunächst Widerspruch, wurde aber wegen der Erfordernisse der Zeit anerkannt und durchgeführt (Esra Kap. 9 und 10; Nehemia 13, 23 ff.). Als später, zur Zeit der Makkabäer, Mischehen wiederum besonders zahlreich eingegangen wurden (Makk 1, 12 ff.), wurden sie von einem hasmonäischen Gericht ein für alle Mal verboten.
Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings, daß auch von christlicher Seite die Mischehe mit Juden verboten wurde, so zum Beispiel durch die Synode von Elvira im Jahre 306 n. Chr., wiederholt durch das Konzil von Chalzedon im Jahre 451 n. Chr. Konstantin der Große untersagte die Mischehe mit Juden gar bei Meidung der Todesstrafe. Der Codex Justiniani vom 13. Februar 528 n. Chr. verbietet sie ebenfalls. Wir können also festhalten, daß sowohl die Juden selbst als auch die Christen in der Diaspora, also in den Ländern, in denen die Reste des von den Römern nahezu vernichteten und aus Palästina vertriebenen Volkes Zuflucht gefunden hatten, sich wechselseitig voneinander abgrenzten. Dies führte unter anderem auch dazu, daß Juden eine besondere Kleidung trugen. Letzteres war allerdings in der mittelalterlichen Ständegesellschaft ohnehin typisch für alle Stände. Es überrascht daher nicht, daß auch für die Juden spezielle Kleidungsstücke vorgeschrieben waren, wie etwa der spitze Judenhut, den wir auf vielen bildlichen Darstellungen des Mittelalters finden. Häufig war auch die Kennzeichnung durch einen gelben Fleck oder Ring aus textilem Material, der auf die Oberbekleidung genäht werden mußte. Wir finden das zum Beispiel in Frankreich. Ludwig der Heilige verfügte dies im Jahre 1269. In Süddeutschland wurde das gemäß Beschluß des Basler Konzils nach 1430 Pflicht. Ausdrücklich vorgeschrieben war das auch im Frankfurter Judenghetto im Jahre 1462. In den schriftlichen Zeugnissen ist insoweit auch von einem Judenring oder Judenkreis die Rede. Bemerkenswert ist, daß diese Kennzeichnungspflicht nicht auf die europäische Diaspora beschränkt war. So soll im Jahre 807 n. Chr. der Kalif Harun al Rashid verfügt haben, daß die Juden gelbe Gürtel zu tragen hätten. Also hielten sowohl die muslimischen Araber als auch die christlichen Europäer eine solche Kennzeichnung, man kann natürlich auch sagen, diskriminierende Kennzeichnung, für erforderlich. Daß dann viele Jahrhunderte später die Nationalsozialisten eine diskriminierende Kennzeichnung in Form des Davidsterns in gelber Farbe eingeführt haben, muß als gehässige Variante dieser Kennzeichnung bewertet werden. Denn sie verband das nationale Symbol des Davidsterns mit der diskriminierenden gelben Farbe. Darin lag natürlich eine bewußte Erniedrigung.
Die Ghettos begünstigten aber auch die Einhaltung der jüdischen Gesetze. Sie ermöglichten eine spezifische Infrastruktur, die koscher produzierenden Metzgern, Bäckern, Köchen und Weinhändlern ein Auskommen bot, und zum Beispiel den Betrieb des rituellen Bades, des Friedhofs wie auch der Synagoge mit ihren Bediensteten ermöglichte. In diesen Ansiedlungen entwickelte sich aber auch die spezielle talmudische Religionsgelehrsamkeit. Alles in allem eine Welt für sich. Die Kontakte zur christlichen Umwelt beschränkten sich damit auf die Ausübung der erlaubten Berufe.
Das Problem der Fremdheit und die Gefahr des Umschlagens in Feindseligkeit
Dieses bewußte Abstandnehmen voneinander ist ganz sicher insbesondere auf Seiten der Juden religiös begründet, wie wir gesehen haben. Doch ist das Phänomen der Ausgrenzung der jeweils Fremden wohl in der menschlichen Natur angelegt. Fremd ist nun einmal das Gegenteil von vertraut, ohne daß damit gleich eine Abwertung verbunden wäre. Der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt meint, dem „Feindschema Fremder“ liege ein „Feindschema Mensch“ zugrunde. Ein Mensch löse beim anderen zunächst einmal Mißtrauen aus; nur wo freundliche Erfahrungen es überlagern, sei dieses Feindschema außer Kraft gesetzt. Einer fürchtet den anderen vorsichtshalber erst einmal, solange der ihm nicht klargemacht hat, daß er ihm nichts Übles will. Einen Hinweis darauf geben die antiken Sprachen, wie sie zur Zeit von Christi Geburt an den Gestaden des Mittelmeers von den dominierenden Völkern gesprochen wurden. Xenos bedeutet im Altgriechischen sowohl Fremder als auch Kriegsfeind, kann aber auch Söldner oder Gastfreund bedeuten. Hostis ist im Lateinischen ursprünglich der Fremde, dann aber auch der Feind. Kamen nun fremdartige Bräuche, gar fremde Götter hinzu, so war das für die Menschen früherer Zeiten Grund genug, Abstand zu halten. Wenn dann noch abergläubische Vorstellungen hinzutraten, konnte aus dem friedlichen Nebeneinander aus nichtigem Anlaß die Katastrophe entstehen.
Die mittelalterlichen Pogrome gegen die Juden zeigen das deutlich. Im 13. Jahrhundert verbreitete sich in der christlichen Bevölkerung Deutschlands das Gerücht, die Juden verübten Ritualmorde an Kindern und vergriffen sich in frevelhafter Weise an geweihten Hostien, indem sie durch Nadelstiche den Kreuzestod Christi nachvollzögen. Die vulgärtheologische Begründung, die Juden seien ja Christusmörder, war weit verbreitet. Vulgärtheologisch deshalb, weil die christliche Heilsgeschichte natürlich Tod und Auferstehung Christi als zentrales Element der Erlösung voraussetzt, womit den Juden jener Zeit eine wichtige Funktion im Heilsplan Gottes zugewiesen wird. Obgleich Kaiser Friedrich II. deshalb eine Kommission einsetzte, welche diese absurden Vorwürfe überprüfte und die Juden davon natürlich freisprach, und auch Papst Innozenz IV. im Jahre 1247 auf Bitten der Juden eine Bulle erließ, die diesen Irrglauben verurteilte, kam es zu einer Vielzahl von Pogromen, in denen jüdische Gemeinden verwüstet und ihre Bewohner erschlagen wurden. Es ist hier nicht der Ort, alle diese Pogrome aufzuzählen. Verschärft wurde die Lage durch das Auftreten der Pest 1348, die von abergläubischen Zeitgenossen natürlich auch den Juden angelastet wurde. Die Pestpogrome breiteten sich seit 1348 über das gesamte Reich aus. Allen Pogromen ist allerdings auch gemeinsam, daß sich dabei nicht nur der Pöbel am Eigentum der Juden vergriff, sondern auch die Fürsten das Vermögen reicher Juden an sich brachten. Manchmal war es auch das kalte Kalkül, das etwa in Nürnberg 1349 zu einem Pogrom gegen die Juden führte, die am Ufer der Pegnitz in der Innenstadt siedelten. Die Nürnberger Bürger wollten dieses Gelände haben, um dort den Marktplatz anzulegen. Kaiser Karl IV. konnte oder wollte den Nürnbergern diese Bitte nicht abschlagen. Wie oft auf diese Weise auch die Schulden bei den jüdischen Pfandleihern getilgt worden sind, kann man sich vielleicht vorstellen.
Glanz und Elend
Diesen finsteren Kapiteln in der langen Geschichte der Juden in Deutschland stehen auch andere, eher glänzende, gegenüber. Denkt man etwa an die portugiesischen Juden, die im 17. Jahrhundert die Hamburger Kaufmannschaft prägten und ihr gesellschaftlichen Glanz verliehen, so kann man kaum glauben, daß Jahrhunderte vorher und nachher Juden Opfer wilder Pogrome waren. Eine besondere Rolle spielten jüdische Bankiers. Der Name Rothschild steht im 18. Jahrhundert für eine Bankiersfamilie, deren Bedeutung in jener Zeit heute kaum vorstellbar ist. Um einen Vergleich zu ziehen, müßte man schon die US-amerikanischen Geldhäuser Goldman Sachs, Morgan Stanley und die ein oder andere europäische Großbank fusionieren lassen. Auch heute noch dürften die Nachkommen der fünf Rothschild-Brüder zu den vermögendsten Familien der Welt zählen. Wie fragil aber auch die Existenz solcher Finanziers tatsächlich war, zeigt das Beispiel Jud Süß Oppenheim. Der rasante Aufstieg vom Geldverleiher zum “ Hof-und Kriegsfaktor“ des Herzogs Karl Alexander von Württemberg, wie auch sein tiefer Fall, ist wohl das beeindruckendste Beispiel dafür, wie ein Außenseiter in schwindelerregendem Tempo größten Reichtum und Einfluß gewinnen kann, seine Abhängigkeit von einem einzigen mächtigen Fürsten jedoch unweigerlich zu seinem Absturz führen muß. Nach dem Tod seines herzoglichen Schuldners wurde der ehemalige „Hofjude“ von den neuen Machthabern an den Galgen gebracht. Daß diese tragische Geschichte mit dem grausamen Ende seines Protagonisten 200 Jahre später den Stoff für einen üblen antisemitischen NS-Propagandafilm gegeben hat, rundet das Bild nachträglich ab.
Der Einfluß der Aufklärung
Ein völlig anderes Bild sehen wir in Deutschland nach der Aufklärung. War jüdische Gelehrsamkeit bis dahin mehr oder weniger auf die Theologie beschränkt, ebnete die Aufklärung den Weg aus den Ghettos zu den Universitäten. Schon einer der maßgeblichen Vertreter der Aufklärung war ein Jude, Moses Mendelssohn (1729-1786). Um wirklich in der modernen aufgeklärten Welt ankommen zu können, mußte ja auch das Judentum seine rückwärtsgewandte Orthodoxie hinter sich lassen. Das begann mit der Haskala, das ist der hebräische Name für die jüdische Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts, und setzte sich fort mit dem Reformjudentum Anfang des 19. Jahrhunderts. Man wandte sich bewußt der europäischen Literatur und Musik zu. Als Beispiel mag der Maler Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) dienen, der im deutschen Bildungsbürgertum jener Zeit zu Hause war, wie auch der Jurist Gabriel Riesser (1806-1863), der es bis zum Abgeordneten in der Paulskirchenversammlung 1849 und zum Obergerichtsrat brachte. Klassisch ist der Lebenslauf des Dichters Heinrich Heine, dessen Werk ja wirklich auch heute noch zum deutschen Bildungskanon gehören. Wie nicht wenige konvertierte er zum Christentum, allerdings wohl weniger aus religiöser Überzeugung, als zur Sicherung seiner Karriere. Sein literarisches Werk zeugt ja an keiner Stelle von Religiosität. Es ist hier nicht der Platz, alle bedeutenden Künstler des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts aufzuzählen, deren Werke aus der deutschen Kultur nicht wegzudenken sind. Ob Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Bruch, Gustav Mahler, Giacomo Meyerbeer, Jacques Offenbach oder Erich Wolfgang Korngold in der Musik, Franz Kafka, Lion Feuchtwanger, Karl Kraus, Kurt Tucholsky oder Stefan Zweig in der Literatur, Albert Einstein, Paul Ehrlich, Heinrich Hertz, Karl Raimund Popper, Hannah Arendt oder Max Born in den Wissenschaften, bedeutende Staatsmänner wie Walter Rathenau oder Henry Kissinger, sie alle werden nur ganz am Rande als Juden wahrgenommen, prägen indessen als Persönlichkeiten die deutsche Kultur- und Wissenschaftsgeschichte bzw. die neuere deutsche Geschichte.
Das Bild des Judentums in Deutschland, aber auch im übrigen Europa, war vielfältig. Fand man vor allem in Osteuropa sehr häufig orthodoxe Juden, die sich durch ihre Lebensweise, bizarre äußere Anmutung und pedantische Befolgung in unseren Augen absurder Speisevorschriften sehr stark von der christlichen Mehrheitsgesellschaft abhoben, so fand man vor allem in Mittel- und Westeuropa vorwiegend liberal gesinnte Juden, nicht selten auch solche, die sich durch religiöse Gleichgültigkeit auszeichneten, oder gar zum Christentum konvertiert waren. Neben dem bereits genannten Heinrich Heine denken wir hier unter anderem an den Vater von Karl Marx, der es aus welchen Gründen auch immer für zweckmäßig hielt, zur evangelisch-lutherischen Konfession überzutreten, was für ihn als Rechtsanwalt in Trier sicherlich kein Nachteil war. Trier lag damals in der preußischen Rheinprovinz. Zwar war die Mehrheit der Bevölkerung katholisch, politisch dominierend waren aber die mehrheitlich protestantischen Preußen. Dennoch spricht man nicht von einer Assimilierung der Juden, vielmehr von einer Akkulturation. Denn die Exklusivität des auserwählten Gottes Volkes behielt man bei. In aller Regel hielt man sich an die religiösen Gebote, vor allem auch an das Verbot der Mischehe mit Andersgläubigen. Der von den Gemeinden auch gar nicht forcierte Übertritt Andersgläubiger zum Judentum war und ist auch nicht so einfach, sondern kann erst nach intensivem Studium der jüdischen Theologie und der einschlägigen religiösen Vorschriften erfolgen. Im gesellschaftlichen Leben indessen wurden liberale bis religiös „unmusikalische“ Juden durchaus als Gleiche unter Gleichen akzeptiert, wenn auch nicht in jeder Hinsicht.
Gesellschaftliche Diskriminierung
Beamter, Richter oder Offizier konnten sie in der Regel nicht werden. Dies waren jedoch die gesellschaftlich anerkannten Berufe. Gerade der Offizier stand in höchstem Ansehen, gleich ob Bürger oder Edelmann. Der Leutnant stand protokollarisch und gesellschaftlich über den höchsten Beamten, von anderen Zivilisten einmal ganz abgesehen. Erst in der höchsten Not des I. Weltkrieges änderte sich das. Wir wissen von einer größeren Zahl von Offizieren jüdischen Glaubens, auch Trägern höchster Kriegsauszeichnungen, wie die mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichneten Jagdflieger Leutnant Fritz Beckhardt und Leutnant Wilhelm Frankl.
Beispielhaft sei kurz die bitter-süße Liebesgeschichte erzählt, die letztlich zum Bau des bekannten Hotels Bühler Höhe im Schwarzwald geführt hat. Herta Schottländer, Tochter eines jüdischen Großgrundbesitzers, heiratete standesgemäß zunächst den viele Jahre älteren jüdischen Bankier und Gutsbesitzer Pringsheim. Er starb 1895, als Herta gerade 24 Jahre alt war. Wenige Jahre später veränderte sich ihr Leben mit der Manöver-Einquartierung eines Kavallerieregiments auf dem Gut der Pringsheims. Herta verliebte sich unsterblich in den schneidigen Regimentskommandeur Oberst Wilhelm Isenbart. Der erlag den Reizen der schönen jungen Witwe und ließ sich scheiden, um sie heiraten zu können. Das war nun aber ein Skandal. Der Ehrenkodex des preußischen Offiziers war nicht nur dadurch verletzt, daß sich der Oberst wegen einer jungen Frau scheiden ließ, sondern vor allem auch dadurch, daß er eine Jüdin heiratete. Wilhelm Isenbart wußte das, und er wußte auch, was er in dieser Situation zu tun hatte. Der Oberst ging zu seinem Kaiser, der ihn zum Generalmajor beförderte und ihm gleichzeitig seinen Abschied gab. So war der Fall des ansonsten tadellosen Offiziers elegant gelöst. Hertas Familie war von der Ehe mit dem Christen ebenso wenig angetan und sie wurde enterbt, jedoch mit einem Pflichtteil in Höhe von immerhin 12 Millionen Goldmark abgefunden. Das wären heute ca. 90 Millionen €. Das auf dem gesellschaftlichen Parkett in Berlin nicht mehr so gern gesehene Paar verzog an die Riviera und reiste viel und gern, bis General Isenbart 1908 in Ägypten verstarb. Von nun an trachtete Herta Isenbart danach, ihrem geliebten Mann ein Denkmal zu setzen. Sie kaufte ein Waldgebiet in der Größe von 18 ha im Schwarzwald und plante dort ein Genesungsheim für verdiente deutsche Generäle zu errichten. Es sollte Platz für zwölf Bewohner nebst Familie und Gesinde haben. Natürlich sollte es „General-Isenbart-Offiziers-Genesungsheim“ heißen. Der aufwendige Bau wurde 1912 begonnen. 1918 nahm sich Herta Isenbart das Leben. Das Haus wurde nie für seinen ursprünglichen Zweck genutzt, sondern zunächst als Kurhaus und später als Hotel. Die Geschichte zeigt wie unter einem Vergrößerungsglas die gesellschaftliche Struktur im 19. Jahrhundert, in der Juden einfach ein geringeres gesellschaftliches Ansehen hatten, unabhängig von Beruf und Vermögen. Spielte eine ähnliche Geschichte in unseren Tagen, so wäre sie gewiß Stoff für die Regenbogenpresse. Die Religion der Beteiligten käme darin allerdings erst gar nicht vor.
Annäherung in der Weimarer Zeit
Der große gesellschaftliche Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg brachte auch für das Leben der Juden in Deutschland bedeutende Veränderungen mit sich. Art. 135 der Weimarer Reichsverfassung gab allen Bewohnern des Reichs volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsausübung wurde durch die Verfassung gewährleistet und stand demgemäß unter staatlichem Schutz. Das wurde zumindest juristisch auch umgesetzt. Jüdischen Juristen und Medizinern stand auch der Staatsdienst offen. Konnten im 19. Jahrhundert auch glänzende Juristen jüdischer Abstammung nur dann im Staatsdienst Karriere machen, wenn sie getauft waren – das bekannteste Beispiel ist Eduard von Simson (1810-1899), getauft 1823, Parlamentarier und erster Präsident des Reichsgerichts seit 1. Oktober 1879 – so fand man während der Weimarer Zeit bis zum Inkrafttreten der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung Juristen nicht mehr nur in den Anwaltskanzleien, sondern auch als Richter und Notare. Der Jurist Hugo Preuß (1860-1925) war 1919 der erste Innenminister der gerade gegründeten Republik und gilt vielen als Vater der Weimarer Verfassung. Man konnte nun auch in der Politik als Jude Fuß fassen, wie gerade das Beispiel Walter Rathenaus zeigt. Allerdings muß auch gesehen werden, daß ein Teil der Bevölkerung nach wie vor die alten Vorbehalte gegen Juden hegte. Dem Haß rechtsextremer Kreise, befeuert von traditionellen antisemitischen Vorstellungen, fiel dann unter anderem auch Walter Rathenau zum Opfer. Auf der anderen Seite war der Einfluß der Juden in der Wirtschaft wie auch im Kulturleben beträchtlich. Verleger wie Leopold Ullstein, der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch und viele Künstler prägten das kulturelle Leben der Republik. Natürlich handelte es sich hier stets um liberale bis religionsferne Persönlichkeiten. Das orthodoxe Judentum spielte keine Rolle, sondern blieb im wesentlichen auf Osteuropa beschränkt. Bemerkenswert, wenn auch nicht zu verallgemeinern, ist das Verhalten des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Selbst christlicher Herkunft, hatte er kein Problem damit, eine Jüdin zu heiraten und seine Bücher von einem jüdischen Verleger (Samuel Fischer) veröffentlichen zu lassen.
Dennoch kann der seinerzeit nicht nur in Deutschland virulente Antisemitismus nicht ganz übersehen werden. Die NSDAP wuchs ja in der Weimarer Zeit erst auf. Sie war von Anbeginn eine extrem antisemitische Bewegung mit wachsender Anhängerzahl. Das Verhältnis der deutschen Mehrheit zur immer noch sehr kleinen jüdischen Minderheit (0,8 % der Bevölkerung) war ambivalent. Großer Akzeptanz in liberalen und kulturaffinen Kreisen standen Ablehnung und Diskriminierung seitens der politischen Rechten gegenüber.
NS-Zeit
Mit dem 30. Januar 1933 änderte sich die Lage der Juden in Deutschland schlagartig. Dazu muß nicht viel gesagt werden. Der Sachverhalt ist bekannt. Die Juden wurden erst durch die Rassengesetze rechtlos gemacht und dann der zynisch „Endlösung“ genannten Vernichtung zugeführt. Deutsche Juden waren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Opfer des Holocaust, die allgemein mit gegen 6 Millionen Menschen beziffert wird, auf den ersten Blick mit ca. 160.000 nur gering betroffen. Tatsächlich aber wurden auch sie nahezu vollständig ausgelöscht, soweit sie nicht rechtzeitig ausgewandert waren, denn nach dem Kriege zählte man nur noch ca. 15.000 Überlebende.
1945 bis heute
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Nachkriegsentwicklung. Der Antisemitismus war trotz seiner schrecklich konsequenten Gestalt, zu der ihn die Nationalsozialisten ausgeformt hatten, in Europa nicht gänzlich verschwunden. So gab es noch am 4. Juli 1946 in der Stadt Kielce in Polen ein Pogrom, dem 42 Juden zum Opfer fielen. Dabei blieb es nicht. Auch in Krakau, Tarnow und anderenorts gab es Judenverfolgungen. Die exakte Zahl der Opfer ist nicht bekannt. Doch wir untersuchen das Verhältnis von Christen und Juden in Deutschland. In der Nachkriegszeit war das eher ein Nicht-Verhältnis, denn es gab ja kaum noch Juden im Lande. Der Schock des Holocaust, von dem tatsächlich die allermeisten Deutschen wenn überhaupt, nur in vagen Andeutungen gewußt hatten, saß indessen tief. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 kamen dann viele Tausend jüdische Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Viele von ihnen waren es wohl mehr dem Namen nach, denn von wirklich religiöser Prägung. Schließlich war ihnen die Ausübung ihrer Religion in der Sowjetunion ja nicht erlaubt. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland mußte somit eine gewaltige Zahl von Menschen integrieren, die einen völlig anderen soziologischen Hintergrund hatte, als die schon immer in Deutschland lebenden Juden.
Grundsätzliche Probleme zwischen Deutschen und Juden sind nicht auszumachen. Gesellschaftliche Diskriminierung erfahren Juden in Deutschland heute in der Regel ausschließlich durch Muslime, von einer verschwindend kleinen rechtsextremistischen Minderheit einmal abgesehen. Die jüdischen Gemeinden haben auch ihren Platz im öffentlichen Leben. Allerdings muß man bei Lichte besehen feststellen, daß hier eher beiderseits ein freundliches Desinteresse füreinander herrscht. Nach wie vor steht einer wirklichen Integration auf jüdischer Seite das religiös begründete Verbot der Mischehe entgegen. Für Christen, für Menschen ohne Religion erst recht, spielt es aber keine Rolle. Denn erst wenn Menschen über religiöse und nationale Grenzen hinweg heiraten, gehen ehemals Fremde in dem Volk auf, indem sie ihre neue Heimat gefunden haben. Für liberale oder gar religionsindifferente Juden ist das natürlich kein Problem, ebenso wenig wie für die meisten christlich getauften Deutschen, seien sie religiös oder eher religionsfern.
Ergebnis
Die Formel von der christlich-jüdischen Prägung Deutschlands kann bei Lichte besehen nicht als Beschreibung der Wirklichkeit taugen. Das Judentum hat Deutschland historisch nicht geprägt. Jahrhundertelang waren Juden in Deutschland – wie auch im übrigen Europa – eine geduldete, bisweilen wirtschaftlich nützliche, nicht selten diskriminierte und verfolgte Minderheit. Davon zu unterscheiden ist die historische und kulturelle Bedeutung einzelner Persönlichkeiten von überragender Bedeutung für Kunst und Wissenschaft. Was das Christentum angeht, so ist das Judentum sein Vorläufer, aber auch das Fundament, auf dem es errichtet worden ist. Nach christlicher Lehre hat Gott das Volk der Juden gewählt, um als Angehöriger eben dieses Volkes in Menschengestalt, als Sohn Gottes, die Erlösung von der Erbsünde durch seinen Tod am Kreuz und die anschließende Auferstehung von den Toten zu bewirken. „Denn das Heil ist aus den Juden“ schreibt der Evangelist Johannes (4, 22). Nur in diesem Sinn ist der Begriff christlich-jüdisch ein zutreffendes Adjektiv. Die inflationäre Benutzung der Floskel von den christlich-jüdischen Wurzeln unserer Kultur ist wohl nicht zuletzt dem schlechten Gewissen der Deutschen geschuldet. Auch wenn Nationalsozialismus und Holocaust schon mehr als 70 Jahre zurückliegen, und die große Mehrheit der damals lebenden Deutschen keineswegs am Völkermord beteiligt war, so waren damals doch nicht wenige antisemitisch eingestellt. Das war kein Ruhmesblatt in unserer Geschichte, und das wird von den meisten Menschen in unserem Lande auch so gesehen. Das sollte aber nicht dazu führen, gewissermaßen als Kompensation faktenwidrig von einer christlich-jüdischen Tradition unseres Landes zu sprechen. Wir sollten ehrlich sein. Die Tradition unseres Landes ist christlich und humanistisch im Sinne der Aufklärung geprägt. Von den nichtchristlichen religiösen Minderheiten in unserem Lande sind allerdings die Juden die am besten integrierte. Ganz im Gegensatz etwa zu den Muslimen. Die Verfassungstreue der deutschen Juden ist ebenso wenig zweifelhaft, wie ihre Loyalität zu dem Land, dessen Bürger sie sind. Daß sie daneben ein besonderes Verhältnis zum Staat Israel haben, ist sehr verständlich und stört die deutsche Mehrheitsgesellschaft bekanntlich nicht. Denn Israel ist der einzige Staat im Nahen Osten, der unsere kulturellen und demokratischen Standards lebt und gegen eine feindselige Umwelt verteidigt.